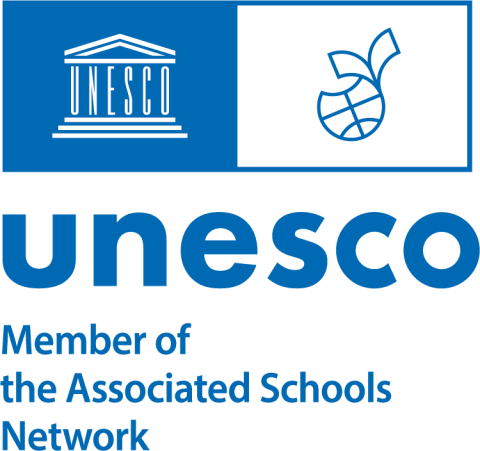Die Anmeldungen für die 1. und 5. Klassen 2026/27 sind abgeschlossen.
Nähere Informationen für Quereinsteiger:innen für das Schuljahr 2026/27 finden Sie hier
Kontakt
Sie haben Fragen?
GRG1 Stubenbastei
Stubenbastei 6-8, 1010 Wien
Telefon: +43 15127810
Fax: +43 15130817
Montag, Mittwoch & Freitag: 07.00 – 13.15 Uhr
Dienstag & Donnerstag: 07.00 – 15.00 Uhr